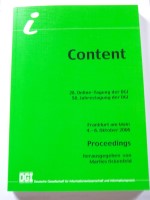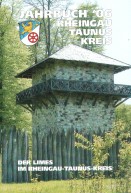Arbeiten statt Bloggen
Jetzt ist das Rätsel gelöst. Warum ist die Blogosphäre hier längst nicht so weit entwickelt, wie in Frankreich oder den USA fragte Jochen Wegner vom Medium Magazin im November in der beiliegenden Journalisten-Doku "Blogs & Co." Gaby Darbyshire, die beruflich Blogger-Geschäftsmodelle entwickelt? Die Antwort verblüfft nicht wirklich, aber in ihrer Deutlichkeit hat dies noch keiner formuliert. "Die Mehrzahl der Deutschen arbeitet zunächst einmal sehr hart und denkt nicht daran, während ihrer Arbeitszeit Weblogs zu schreiben oder zu lesen." Jetzt wissen wir es also. Warum trotz dieses Arbeitseifers die deutsche Wirtschaft krankt, geht aus dieser Antwort zwar nicht hervor, beschreibt aber ein deutsches Phänomen. Sich einer Sache, in diesem Fall der Arbeit, mit Haut und Haaren zu verschreiben, auf dass ein Blick über den Tellerrand möglicher Erkenntnisse nicht mehr möglich ist. Es soll inzwischen sogar wieder Firmen geben, die den Mitarbeitern den Gang zur Teeküche vermiesen. Ein Schritt zurück. Wo sind sie geblieben - die Erkenntnisse moderner Unternehmens- und Mitarbeiterführung? Das "Leben" und "Vorleben" von Unternehmenskultur galt in den Neunziger Jahren als wirtschaftspolitischer Fortschritt. Wahrscheinlich sind Fortschritte in Deutschland nicht mehr en vogue. Statt dessen mit Feuereifer in den Rückschritt, wie es uns derzeit auch eine große Koalition von Wahlverlierern vormacht. Nun gut, in solchen Zeiten braucht es sicherlich auch wieder eine Avantgarde, die die Weichenstellungen für die Zukunft erörtert. Solche Avantgardisten sind in Deutschland sicherlich einige unter den Bloggern zu finden. Also auf in die Zukunft, fordert für heute ihr Kommunikationsfachmann Peter Wolff.
peterwolff - 14. Nov, 13:48
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks